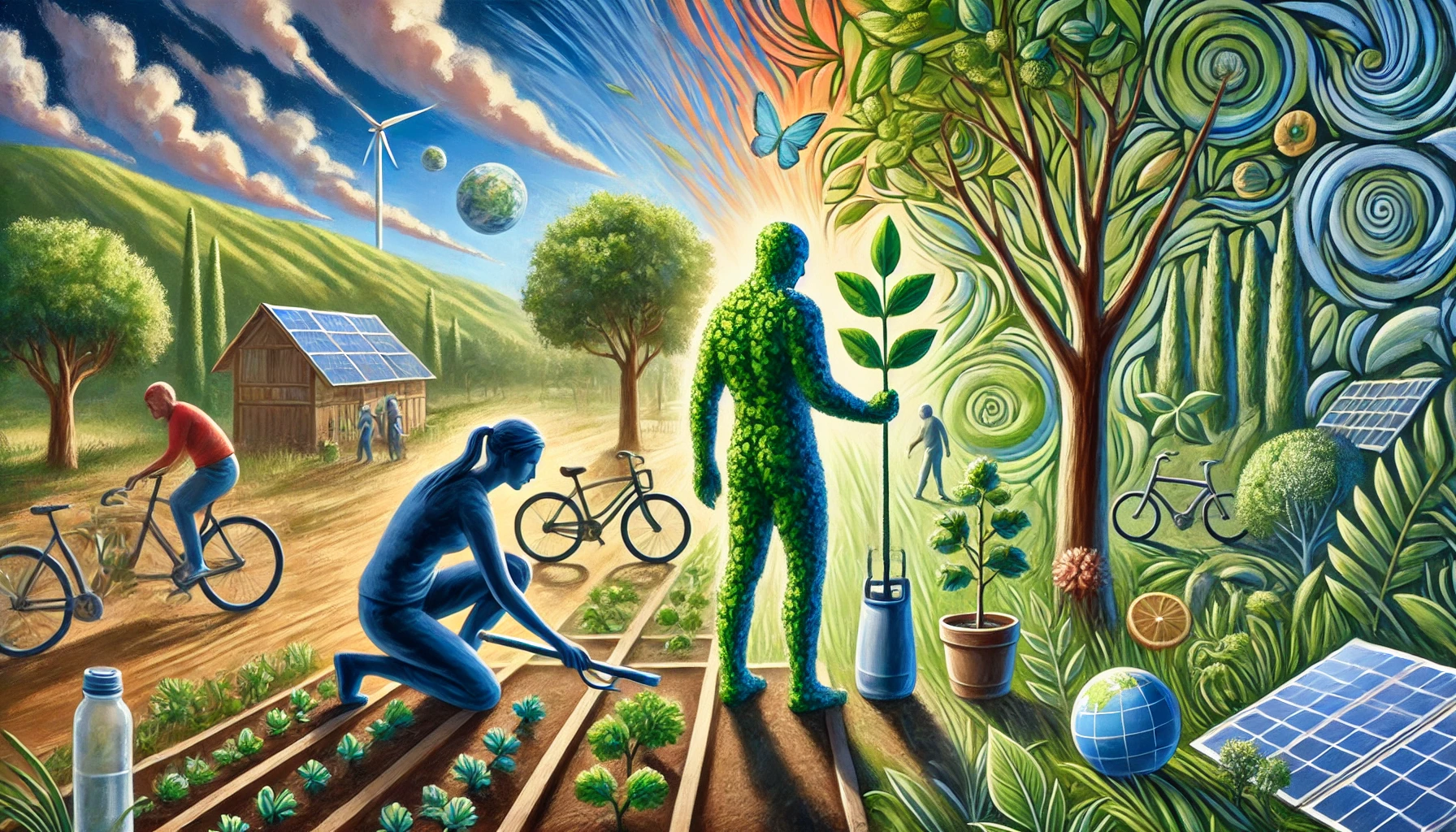ADHS - ein neurobiologischer Kurzüberblick
Voelkner & Radßat GbR • 13. Dezember 2024
ADHS - ein neurobiologischer Kurzüberblick
Was ist ADHS?
Podcast-Folge anhören
ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Es handelt sich um eine neurologische Entwicklungsstörung, die sowohl Kinder als auch Erwachsene betreffen kann. Die Hauptsymptome der ADHS sind Hyperaktivität, Impulsivität, Unaufmerksamkeit und Desorganisation. Die Symptome werden unter anderem dadurch deutlich, dass die betroffene Person motorisch unruhig ist, den Fokus der Aufmerksamkeit kaum längerfristig auf eine Aufgabe richten kann und leicht durch Geräusche in der Umgebung ablenkbar ist.
Wie sind die Symptome von ADHS neurologisch erklärbar?
Neurologisch sind die Defizite sehr gut erklärbar, denn bei der ADHS liegt unter anderem eine Fehlfunktion des Belohnungssystems vor: Dopamin ist ein Neurotransmitter und Hormon, das zum einen ausgeschüttet wird, wenn eine Person belohnt wird, und zum anderen, wenn eine Person eine zukünftige Belohnung erwartet, das heißt, antizipiert. Belohnung wird beispielsweise antizipiert, wenn ein Kind für eine Klassenarbeit lernt und erwartet, für das Lernen durch eine gute Schulnote belohnt zu werden. Während des Lernens und während der Belohnungsantizipation zeigen Nervenzellen im Gehirn, die für Dopamin verantwortlich sind, eine verstärkte Aktivität, was zur Folge hat, dass das Hormon Dopamin vermehrt freigesetzt wird. Dadurch wird das Kind schon während des Lernens für das Durchhalten belohnt und das Lernen wird fortgeführt. Personen mit ADHS können zwar eine zukünftige Belohnung antizipieren, jedoch führt dies nicht dazu, dass die Nervenzellen, die für Dopamin verantwortlich sind, ihre Aktivität steigern. Ein Belohnungsempfinden während des Lernens bleibt aus. Personen mit ADHS können also nur ein Belohnungsempfinden während einer tatsächlichen Belohnung, aber kaum während einer Belohnungsantizipation verspüren (Ziegler et al., 2016). Die Folge dessen ist eine starke Belohnungssuche, die sich in einem hyperaktiven und impulsiven Verhalten zeigt (Tripp & Wickens, 2008), um ständig kleine Belohnungen zu erfahren, sodass das Bedürfnis nach dem positiven Belohnungsempfinden gestillt wird.
Weiter liegt bei Personen mit ADHS eine Fehlfunktion der Aufmerksamkeitsregulation vor. Vor allem unser hinterer Hirnbereich ist dafür verantwortlich, die Aufmerksamkeit auf plötzliche, potenziell bedrohliche Reize wie Geräusche in der Umwelt zu lenken. Das nennt sich „Bottom-Up-Regulation“ der Aufmerksamkeit. Bei Patienten mit ADHS ist diese Regulation so empfindlich bzw. sensitiv, dass die Aufmerksamkeit auch schon auf kleinste, eigentlich irrelevante Geräusche in der Umgebung gelenkt wird (Arnsten, 2009). Die Folge ist, dass die Person mit ADHS sehr unfokussiert, unaufmerksam und leicht ablenkbar ist. Weiter zeigen sich bei Personen mit ADHS in einigen Gehirnbereichen eine grundsätzlich verminderte Aktivität (Dickstein et al., 2006) und ein Entwicklungsdefizit (Shaw et al., 2007).
Wie wird ADHS behandelt?
Die besten Wirksamkeitsnachweise gibt es bei ADHS für die multimodale Behandlung (MTA Cooperative Group, 1999; Jensen et al., 2007; Swanson et al., 2007). Es handelt sich um einen Behandlungsansatz, der eine medikamentöse sowie psychotherapeutische Behandlung beinhaltet und das familiäre und bei Kindern schulische Setting mit einbezieht.
Literaturverzeichnis:
Arnsten, Amy F.T. „ADHD and the Prefrontal Cortex“. The Journal of Pediatrics 154, Nr. 5 (Mai 2009): I-S43. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2009.01.018.
Dickstein, Steven G., Katie Bannon, F. Xavier Castellanos, und Michael P. Milham. „The Neural Correlates of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: An ALE Meta‐analysis“. Journal of Child Psychology and Psychiatry 47, Nr. 10 (November 2006): 1051–62. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01671.x.
MTA Cooperative Group. „A 14-Month Randomized Clinical Trial of Treatment Strategies for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder“. Archives of General Psychiatry 56, Nr. 12 (1. Dezember 1999): 1073. https://doi.org/10.1001/archpsyc.56.12.1073.
Shaw, P., K. Eckstrand, W. Sharp, J. Blumenthal, J. P. Lerch, D. Greenstein, L. Clasen, A. Evans, J. Giedd, und J. L. Rapoport. „Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Is Characterized by a Delay in Cortical Maturation“. Proceedings of the National Academy of Sciences 104, Nr. 49 (4. Dezember 2007): 19649–54. https://doi.org/10.1073/pnas.0707741104.
Swanson, James M., Stephen P. Hinshaw, L. Eugene Arnold, Robert D. Gibbons, Sue Marcus, Kwan Hur, Peter S. Jensen, u. a. „Secondary Evaluations of MTA 36-Month Outcomes: Propensity Score and Growth Mixture Model Analyses“. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 46, Nr. 8 (August 2007): 1003–14. https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e3180686d63.
Tripp, Gail, und Jeff R. Wickens. „Research Review: Dopamine Transfer Deficit: A Neurobiological Theory of Altered Reinforcement Mechanisms in ADHD“. Journal of Child Psychology and Psychiatry 49, Nr. 7 (Juli 2008): 691–704. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01851.x.
Jensen, Peter S., L. Eugene Arnold, James M. Swanson, Benedetto Vitiello, Howard B. Abikoff, Laurence L. Greenhill, Lily Hechtman, u. a. „3-Year Follow-up of the NIMH MTA Study“. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 46, Nr. 8 (August 2007): 989–1002. https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e3180686d48.
Ziegler, Sigurd, Mads L. Pedersen, Athanasia M. Mowinckel, und Guido Biele. „Modelling ADHD: A review of ADHD theories through their predictions for computational models
Zum Podcast
Wenn du die Podcast-Folge zum Thema anhören möchtest, dann klicke auf den Button.

In diesem Artikel erklären wir, warum nicht jeder Mensch nach einem traumatischen Ereignis eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entwickelt. Wir beleuchten die neurobiologischen Prozesse, die Rolle des Trauma-Gedächtnisses und Risikofaktoren, die die Entwicklung einer PTBS beeinflussen können.

In diesem Artikel stellen wir das Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) vor, eine speziell für die Behandlung chronischer Depressionen entwickelte Therapieform. Wir erklären die theoretischen Grundlagen, den Ablauf der Therapie und wie CBASP hilft, interpersonelle Defizite zu überwinden.
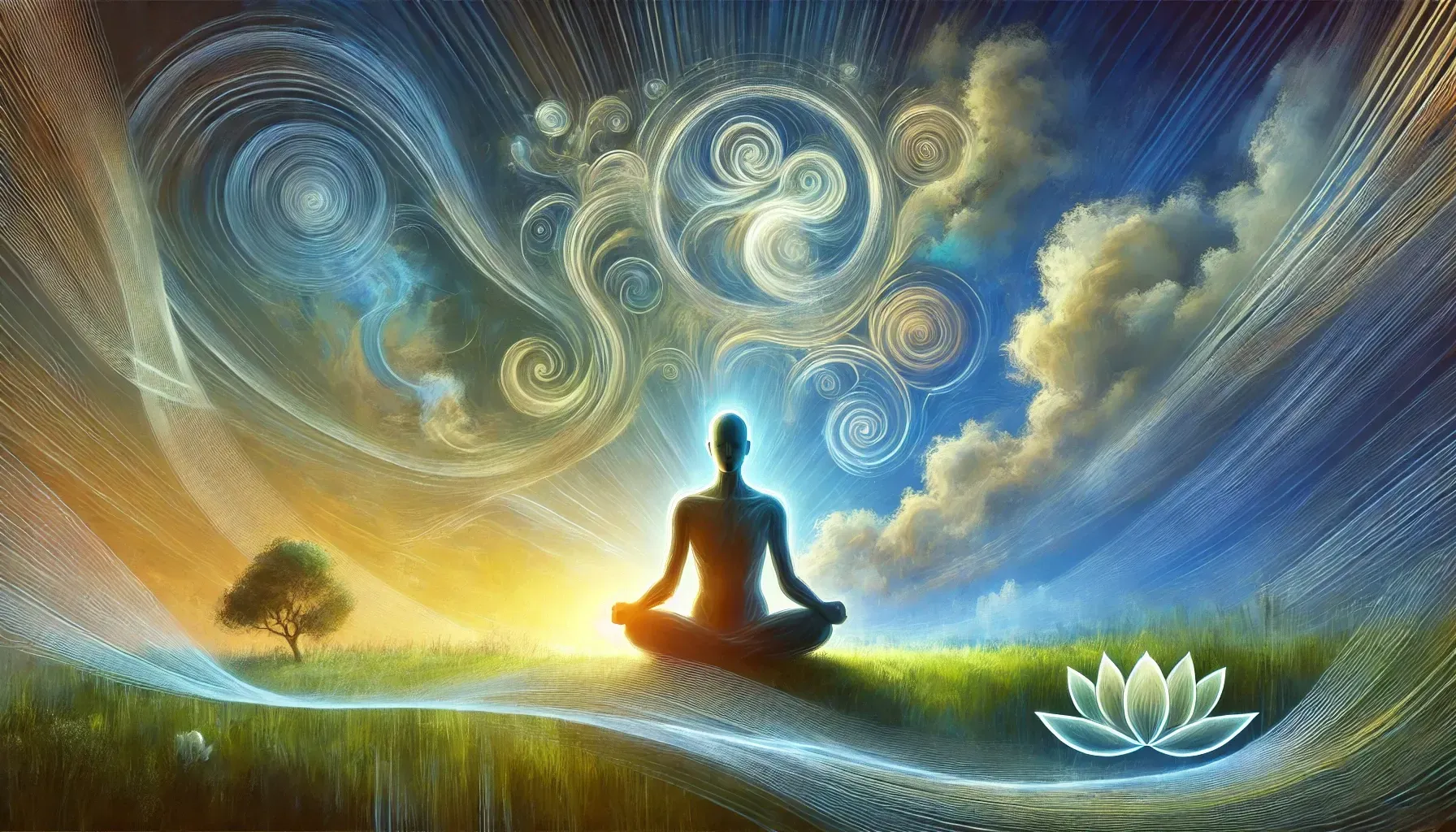
In diesem Artikel beleuchten wir die Rolle der Achtsamkeit in der modernen Psychotherapie, insbesondere in der Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT). Wir diskutieren die Ursprünge der Achtsamkeit, ihre Integration in therapeutische Ansätze und stellen praktische Übungen vor, die helfen können, psychische Belastungen zu reduzieren.